
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
Wirtschaftsingenieur (B.Sc.) - Technik Know-How als Erfolgs-Faktor
Der am besten bewertete duale Studiengang Deutschlands
Wirtschaftsingenieurwesen ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das die Ingenieurwissenschaften mit den Wirtschaftswissenschaften verbindet.
Ziel des Wirtschaftsingenieurwesens ist es, technische und betriebswirtschaftliche Prozesse zu analysieren und zu optimieren, um die Effizienz und Effektivität in Unternehmen und Organisationen zu steigern. Dies umfasst Bereiche wie Produktion, Logistik, Projektmanagement, Qualitätsmanagement und technisches Marketing.
Was bedeutet es, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren?
Ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens vermittelt den Studierenden umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten in den genannten Bereichen. Es bietet eine fundierte theoretische Grundlage und fördert gleichzeitig praxisorientiertes Denken und Handeln. Studierende lernen, komplexe technische und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und Lösungen für technische und organisatorische Probleme zu entwickeln. Zudem werden soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeiten und Führungskompetenzen gefördert.
Wirtschaftsingenieurwesen an der NORDAKADEMIE im dualen Studium
Das duale Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der NORDAKADEMIE bietet eine besondere Form der Ausbildung, die Theorie und Praxis eng miteinander verknüpft. An der NORDAKADEMIE bedeutet dies, dass die Studierenden abwechselnd in Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen im Unternehmen lernen. Dies ermöglicht den Studierenden, das Gelernte direkt im beruflichen Umfeld anzuwenden und gleichzeitig wertvolle Berufserfahrung zu sammeln.
Durch diese enge Verzahnung von Hochschulbildung und beruflicher Praxis werden die Absolventen optimal auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet. Zudem unterstützt die enge Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen eine praxisnahe Ausbildung und bietet den Studierenden exzellente Karrierechancen.
Im CHE Ranking 2020 hat der duale Studiengang der NORDAKADEMIE bundesweit am besten abgeschnitten. Wann bist du dabei?

Deine Zukunft beginnt jetzt
Deine Zukunft beginnt jetzt
Vielfalt
Chancen
Bestnote
Vielfalt
Chancen
Bestnote
Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen
Organisatorische Fakten
Studienbeginn
In der Regel am 1. Oktober des jeweiligen Jahres
Studiendauer
7 Semester Regelstudienzeit
Abschluss
Bachelor of Science mit 210 ECTS-Punkten
Studienorganisation
13 Wochen/Halbjahr im Unternehmen,
10 Wochen/Halbjahr an der NORDAKADEMIE
Schwerpunktbildung
Studiengebühr
Wird in der Regelstudienzeit vom Unternehmen gezahlt
Ausbildungsvergütung
Status
Studienbeginn
In der Regel am 1. Oktober des jeweiligen Jahres
Studiendauer
7 Semester Regelstudienzeit
Abschluss
Bachelor of Science mit 210 ECTS-Punkten
Studienorganisation
13 Wochen/Halbjahr im Unternehmen,
10 Wochen/Halbjahr an der NORDAKADEMIE
Schwerpunktbildung
Studiengebühr
Wird in der Regelstudienzeit vom Unternehmen gezahlt
Ausbildungsvergütung
Status
Bis zu
700
freie Bachelor- und Master-Studienplätze pro Jahr
Über
400
Bachelor-Absolvent:innen jährlich
Mehr als
300
Bildungspartner mit mind. 1 Studierendem
Bis zu
700
freie Bachelor- und Master-Studienplätze pro Jahr
Über
400
Bachelor-Absolvent:innen jährlich
Mehr als
300
Bildungspartner mit mind. 1 Studierendem
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
Informationen zum Studium
Im dualen Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen“ an der NORDAKADEMIE erhältst du zunächst ein breites Grundlagenwissen zu allen Funktionsbereichen eines Unternehmens.
Im fünften bis siebten Semester vertiefst du dann die zentralen Inhalte der Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften sowie des Technologiemanagements. Zu den Pflichtveranstaltungen gehören Maschinentechnik, Produktions- und Qualitätsmanagement, Logistik- und Prozessmanagement, Investitionsgütermarketing sowie Controlling und Investition.
Mit der Vermittlung aller notwendigen Kenntnisse zum Einsatz von Informationstechnik liegt ein weiterer Fokus des Curriculums auf der Integration. Last but not least erhältst du wichtiges Fachwissen in den für die Wirtschaft relevanten Bereichen des Rechts.
Darüber hinaus bietet dir die NORDAKADEMIE Wahlmöglichkeiten zur individuellen Vertiefung. Auch den Bereich „Seminare“ im Rahmen des Studium Generale kannst du flexibel dafür nutzen.
Dein Bachelor-Studium befähigt dich dazu, Unternehmensentscheidungen in allen Funktionsbereichen auf Basis wissenschaftlicher Methoden vorzubereiten und erfolgreich umzusetzen. Im Vordergrund stehen die Schnittstellen zwischen technischen und betriebswirtschaftlichen Aufgaben.
Dank des dualen Systems sind die Inhalte deines Studiums eng mit den Anforderungen deines Ausbildungsbetriebs verzahnt.
Individuelle Spezialisierung
Durch die Wahl eines Schwerpunkts kannst du dich auf einen Bereich spezialisieren. Dazu gehören:
Oder du studierst Wirtschaftsingenieurwesen ohne Schwerpunkt und wählst daher
Verschaffe dir hier einen Überblick über die Lerninhalte der einzelnen Semester:

Änderungen vorbehalten. Es gilt die aktuelle Prüfungsordnung.
Wirtschaftsingenieur:innen können gleichzeitig in zwei Richtungen denken – einerseits technisch und andererseits kaufmännisch. Diese Vielseitigkeit prädestiniert sie für herausfordernde interdisziplinäre Aufgaben und macht sie zu gesuchten Fach- und Führungskräften.
Weil sie technische Abläufe im Unternehmen gestalten und Geschäftsprozesse unter technischen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten analysieren können, eröffnen sich Wirtschaftsingenieur:innen viele Einsatzmöglichkeiten. Etwa hier:
- Produktion
- Transport/Verkehr/Logistik
- Marketing/Vertrieb
- Beratung
- Controlling
- Informatik
- Einkauf
- Organisation
- Finanzwesen
- Forschung & Entwicklung
- Personal
Gut zu wissen: Bereits mit der Wahl deines Ausbildungsbetriebs kannst du bestimmen, in welche Richtung du gehen möchtest. Außerdem geben dir diverse Wahlpflichtfächer während des Studiums die Möglichkeit, einen individuellen Schwerpunkt zu setzen und dich auf ein Fachgebiet zu spezialisieren.
Dualer Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Erfahrungsbericht
Marco Trieder
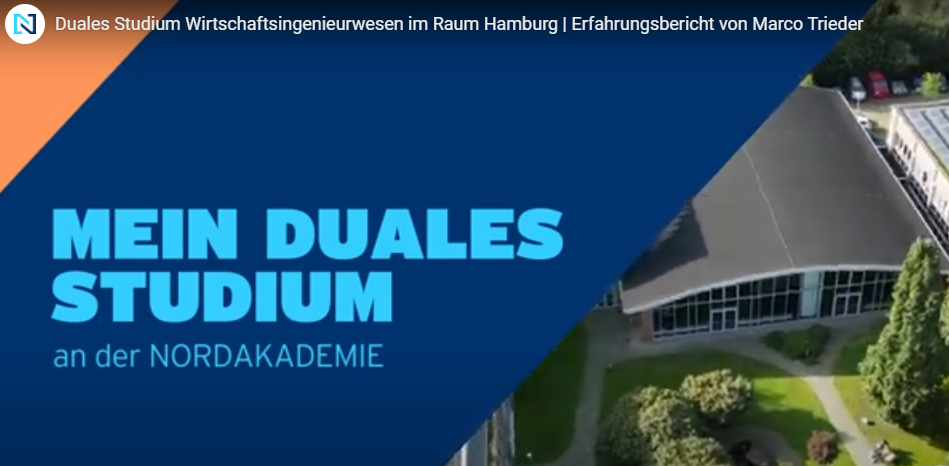
Wir brauchen Ihre Einwilligung. Dieser Inhalt wird von YouTube bereitgestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.
Duales Studium (B.Sc.) - Wichtige Facts
Allgemeines
Bewerbung auf dein duales Studium
- Bachelorbewerbung an der NORDAKADEMIE
- Bewerbung beim Wunschunternehmen
- Auswahlverfahren im Unternehmen
- Vertrag mit dem Unternehmen und Immatrikulation an der NORDAKADEMIE
Bewerbungsfristen für dein duales Studium
Es gibt an der NORDAKADEMIE keine Bewerbungsfristen. Die aktuelle Liste freier Studienplätze ist immer ab Juni des Vorjahres auf unserer Webseite verfügbar. Wir empfehlen dir deshalb, dich ca. 12 bis 15 Monate vor Studienbeginn zu bewerben.
Kooperationsbetriebe
Die tagesaktuelle Studienplatzliste gibt dir einen Überblick über alle Kooperationsbetriebe, die für das ausgewiesene Kalenderjahr noch Studienplätze zu vergeben haben.
Studienbedingungen
- Praxiserfahrene Dozent:innen
- Umfangreiche persönliche Betreuung
- Unterricht in Kleingruppen
- Unterrichtsräume mit modernster Ausstattung, E-Learning-Plattform und täglicher 24-Stunden-Zugang zum Gebäude
- Naturnah gestalteter Campus mit Erholungs- und Sportmöglichkeiten
Besondere Anforderungen
- Komprimierte Studienzeiten
- Keine langen Semesterferien
- Einsatzbereitschaft und Engagement in Beruf und Studium gefordert
Studium Generale
Damit die NORDAKADEMIE dich umfassend und interdisziplinär ausbilden kann, ist deine Teilnahme an Seminarveranstaltungen aus unserem umfangreichen Angebot verpflichtender Bestandteil des Curriculums.
Über 100 wählbare Seminarveranstaltungen ergänzen die Pflicht- und Prüfungsfächer dabei um Veranstaltungen zu Persönlichkeitsentwicklung sowie aktuellen Management- und fachbezogenen Spezialthemen. Sie erstrecken sich über den gesamten Studienverlauf und sind von den fachlichen Modulen inhaltlich unabhängig.
Infos zur Seminar-An- und -Abmeldung sowie zur Teilnahmeverpflichtung an Seminaren findest du im "Merkblatt Seminare" im Intranet CIS.
Hochschulstudium und Unternehmenspraxis werden stärker denn je von wissenschaftlichen Prozessen durchdrungen. Um von Anfang an effizient lernen zu können ist es deshalb wichtig, dass du fundiert wissenschaftlich arbeiten und entsprechende Methoden optimal nutzen kannst. Passend dazu gibt es im ersten Semester die Seminarveranstaltung "Wissenschaftliches Arbeiten und Methoden", die von allen Studierenden belegt werden muss.
Fremdsprachen
Damit du international gut aufgestellt bist, ist das Fremdsprachenangebot der NORDAKADEMIE zentraler Baustein des dualen Studiums. Den wachsenden Ansprüchen an die Sprachkenntnisse begegnen wir mit fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen als Wahlpflichtfächer oder im Rahmen der freiwilligen Seminare.
Unterrichts- und Prüfungssprache ist Deutsch, außer es handelt sich um ein englischsprachiges Fachmodul. Weitere Sprachen können individuell im Studium Generale gewählt werden.
International Office
Das International Office bzw. Akademische Auslandsamt unterstützt die Studierenden der NORDAKADEMIE bei der Vorbereitung ihres Auslandssemesters. Mit Unterstützung des studentischen Auslandsreferates informiert es unter anderem über Studienmöglichkeiten an ausländischen Partnerhochschulen.
Darüber hinaus ist das International Office erster Ansprechpartner für unsere ausländischen Gaststudierenden.
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr
Studiengebühren
Währen der sieben Semester Regelstudienzeit zahlt dein Ausbildungsbetrieb deine Studiengebühren. Weitere Informationen können der aktuellen Gebührenordnung entnommen werden.
Zulassungsbedingungen
Um bei der NORDAKADEMIE ein duales Studium beginnen zu können musst, du eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, das Online-Auswahlverfahren an der NORDAKADEMIE bestanden und ein Partnerunternehmen 2026 für das duale Studium gefunden haben.
Solltest du deinen Schulabschluss außerhalb von Deutschland erworben haben, musst du ggf. die Hochschulzugangsberechtigung vorab prüfen lassen. Bitte informiere dich in unseren FAQ’s über die Zulassungsvoraussetzungen für internationale Bewerber:innen
Bewerbungsprozess
Informiere dich hier über unseren mehrstufigen Bewerbungsprozess: Duales Bachelor-Studium: So ist dein Weg an die NORDAKADEMIE – Bewerbung
Studiendauer
Das duale Studium an der NORDAKADEMIE dauert sieben Semester – und damit ein Semester länger als allgemein an einer Uni. Das hat einen guten Grund: Unsere Partnerunternehmen sind zur Überzeugung gelangt, dass sechs Semester nicht ausreichen, um alle relevanten Praxis- und Theorieinhalte zu vermitteln. Für dich bedeutet das: Du hast genügend Zeit für eine fundierte Ausbildung und erwirbst ausreichende Qualifikationen, um aktiv im Unternehmen mitzuarbeiten. Außerdem erarbeitest du dir 210 Kreditpunkte statt nur 180 – die Grundvoraussetzung für ein berufsbegleitendes Masterstudium an der NORDAKADEMIE.
Transferleistungen Theorie/Praxis
Beim dualen Studium an der NORDAKADEMIE erwirbst du auch für die Praxisphasen Kreditpunkte. Zum Erwerb von insgesamt 30 Kreditpunkten für die Praxisphasen sind deshalb Prüfungen in Form von Transferleistungen Theorie/Praxis (ehemals "Praxisberichte") vorgesehen.
Transferleistungen dienen der Dokumentation von erlernten Zusammenhängen zwischen Theorie und Praxis. Hier kannst du zeigen, dass du die im Unternehmen erworbenen Kompetenzen mit den in den Theoriephasen vermittelten Inhalten verknüpfen, sie anhand dieser auch bewerten und in einen Gesamtzusammenhang innerhalb des Studiums einordnen kannst.
Leben und lernen auf dem Nachhaltigkeitscampus Elmshorn
Auf dem fast 18.000 m2 großen Gelände der NORDAKADEMIE in Elmshorn kannst du lernen, wohnen, essen und Kontakte knüpfen. Der großzügige naturnahe Campus lädt zum Verweilen an der frischen Luft ein und verfügt über modern ausgestattete Gebäude, ein Audimax, eine Mensa und ein Wohnheim. Das macht Elmshorn zu einem attraktiven Hochschulstandort im Großraum Hamburg.
Du erreichst den Bahnhof in Elmshorn innerhalb von 10 Gehminuten vom Campus aus.
Besondere Highlights und weitere Infos zum Campus in Elmshorn
Seit Januar 2015 betreibt die NORDAKADEMIE gemeinnützige AG in Elmshorn ein hochschuleigenes Wohnheim. Darüber hinaus kannst du auf dem Campus der NORDAKADEMIE im Studentenwohnheim des privaten Betreibers EMV Immobilien-Management ein Einzelzimmer mieten. Das Niedrigenergiehaus besteht aus zwei Etagen mit jeweils 20 Zimmern.
Labore der NORDAKADEMIE 🔬
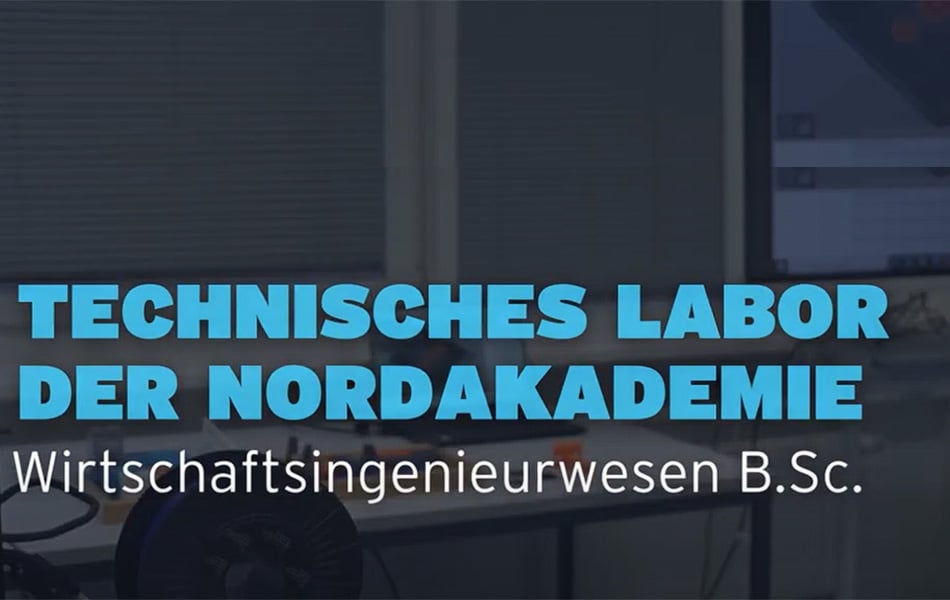
Wir brauchen Ihre Einwilligung. Dieser Inhalt wird von YouTube bereitgestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.


Melina
Die im Rahmen des dualen Studiums vermittelten betriebswirtschaftlichen Basics in Verbindung mit dem technischen Know-How inklusive der Praxiserfahrungen im Unternehmen bereiten mich als zukünftige Wirtschaftsingenieurin optimal auf die Berufswelt vor.


Luis


Tim Rechenbach, AIRBUS
Deine Zukunft
Renommierte Praxispartner
für deinen Erfolg von Anfang an
Direkter Draht
zu unserem Team






